Interview mit Urs Staub vom Bundesamt für Kultur Juni 2009
Für die experimentelle Kultur wird es eng werden
www.annelisezwez.ch Annelise Zwez in Bieler Tagblatt vom 20. Juni 2009
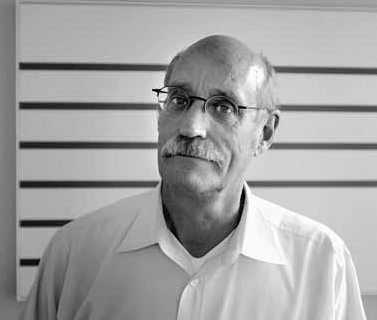
Der Kulturbetrieb ist in hohem Mass abhängig von öffentlichen Geldern. Werden diese als Folge der Wirtschaftskrise nun massiv gekürzt werden? Ein Gespräch mit Urs Staub vom Bundesamt für Kultur.
A.Z.Das opulente Kultur-Angebot, das kürzlich rund um die Basler Kunstmesse serviert wurde, wirkte auf mich wie die Tanne, die nie so viele Zapfen produziert wie kurz vor dem sterben. Sind Sie optimistischer?
Urs Staub: Ja, ich bin optimistischer. Wir haben möglicherweise ein Zapfenjahr, das Kunst-Angebot war enorm, das fiel mir auch auf. Aber die Vielfalt stimmt mich positiv, es ist eine reiche Basis, auch wenn die nächsten Jahre vielleicht eine Durststrecke bringen. Denn es ist klar, dass jene, die das Gesellschaftsspiel des Kunstsammelns in den letzten Jahren kräftig angeheizt haben, nurmehr so viel ausgeben können, wie ihnen nach den Verlusten an der Börse noch zur freien Verfügung steht, falls überhaupt.
Fakt ist auch, dass die Wirtschaftskrise die Steuereinnahmen massiv einbrechen lassen wird. Wie schätzen sie die Gefahr ein, dass zuerst bei der Kultur gespart wird?
Diese Gefahr besteht. Ich glaube aber nicht, dass jetzt sofort auf die Kultur losgegangen wird. Bei den Einbrüchen der letzten Jahrzehnte, es ist ja nicht das erste Tief, hat sich gezeigt, dass es prozentual bei der Kultur gar nicht sehr viel zu sparen gibt. Es hat sich auch im Parlament, in den Kantonen und vor allem den Städten durchgesetzt, dass an der Kultur sparen nicht intelligent ist, da sie Standortvorteile generiert. Aber mit einer Stagnation ist zu rechnen. Die kulturellen Institutionen können in den nächsten Jahren kaum mit höheren Subventionen rechnen, und ich kann mir vorstellen, dass es da und dort auch Einbrüche geben wird. Schwarz sehe ich aber nicht.
Die Kulturförderung ist in der Schweiz sehr stark auf Kantons- und Gemeindeebene angesiedelt. Werden die Reaktionen auf die Krise in verschiedenen Teilen der Schweiz sehr unterschiedlich sein?
Das kann sehr gut sein. Diese Unterschiede haben wir bereits heute. Es gibt Kantone, die enorm viel machen und solche, die wenig machen oder sogar etwas abgeschlagen sind. Das hängt aber nicht nur mit den Steuereinnahmen zusammen. Darum ist es möglich, dass dort, wo Kulturförderung heute schon wenig Bedeutung hat, schneller die Meinung auf kommt, man könne da sparen als in Kantonen, in denen die Kulturförderung etabliert ist.
Können sie das konkretisieren?
Vorbildlich agiert, man darf das sagen, der Kanton Zürich. Im vorderen Mittelfeld ist zum Beispiel auch der Kanton Aargau zu nennen, der sehr viel macht. Eher Mühe habe ich persönlich mit dem Kanton Schwyz, immerhin einer der reichsten Kantone der Schweiz, und dasselbe gilt auch für Nidwalden. In diesen kleinen Kantone im Schatten der grossen wäre von den Steuereinnahmen her ein wesentlich grösseres Kulturengagement möglich.
Und der Kanton Bern?
Bern hat das Problem aller Kantone, die grosse Städte haben. Da gibt es Zentrumslasten und damit Verschiebungen. Die Stadt Bern hat Mühe mit ihren Aufgaben als Hauptstadt. Aber gesamthaft, denke ich, leistet der Kanton im Rahmen seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten gute Arbeit. Es läge aber auch mehr drin. Immerhin gibt es hier mehr als anderswo private Institutionen, welche die öffentliche Kulturförderung ergänzen im Bereich der bildenden Kunst zum Beispiel das Aeschlimann-Corti-Stipendium.
Vielleicht muss man für eine Analyse die Betrachtungsweise umkehren und fragen: Inwieweit hat die Kultur den Konjunkturaufschwung der letzten Jahre ausgenutzt und ist dabei mit ihren Angeboten übers Ziel hinausgeschossen?
Das sehe ich so. In letzter Zeit war es aber nicht nur die Konjunktur, die den Kulturbetrieb aufgeheizt hat, sondern auch die Erkenntnis, dass Kultur Standortvorteile bietet. Das hat selbst kleinere Gemeinde zu bedeutenden Kulturausgaben bewogen. Betrachte ich ich bin ja auch Präsident des Schweizer Museumspasses – zum Beispiel den Sektor Museen, aber auch denjenigen der alternativen Kulturforen, so sehe ich vielfach tolle Arbeit, stelle aber gleichzeitig klar ein Überangebot fest. Darum meine ich, dass ein Sterben da und dort unumgänglich ist; es hat ja auch bereits begonnen.
Was heisst schon begonnen?
Es gibt Institutionen mit grossen finanziellen Problemen, zum Beispiel das Architekturmuseum in Basel, das einzige seiner Art in der Schweiz notabene, es gibt aber auch andere, die gefährdet sind, zum Beispiel das Alpine Museum in Bern, wo man sich zur Zeit heftig streitet, ob ein solches nun Bundes-, Kantons- oder städtische Aufgabe sei und der Ausgang angesichts der öffentlichen Finanzlage offen ist.
Was für die öffentlichen Gelder gilt, trifft in noch höherem Mass auf die Sponsoren-Gelder zu. Die 20 Millionen der UBS für die Basler Van Gogh-Schau wirken wie ein höhnisches Echo aus besseren Zeiten. Wird die Wirtschaft der Kultur den Rücken drehen?
Das glaube ich nicht. Aber es wird enger. Die Wirtschaft überlegt sich zurzeit dreimal, was sie sponsert und was nicht; übrigens nicht nur im Bereich Kultur, sondern auch bei Parteispenden, im Sport usw. Dabei sehe ich die Gefahr, dass sie nur noch Dinge mit grosser Akzeptanz unterstützen wird, während kreative, junge, experimentelle Projekte leer ausgehen. Im Übrigen finde ich persönlich, man hätte mit den 20 Millionen in anderen Bereichen der Kultur sehr viel mehr Wirkung erreichen können als mit einer weiteren Van Gogh-Ausstellung. Aber ich weiss, es geht nicht nur um Kultur, es spielen auch wirtschaftliche und politische Überlegungen eine wichtige Rolle.
Was die Situation so paradox macht, ist, dass die Krise die Realwirtschaft erreicht hat, die Auswirkungen auf viele Bereiche aber immer noch zukünftig sind und darum noch nicht im Zentrum der Diskussionen. Steckt die Kultur den Kopf in den Sand?
Das ist so. Wir haben das schon in den 90er-Jahren erlebt. Die öffentliche Hand reagiert später auf einen Einbruch, dafür geht es dann auch bei einem Aufschwung länger, bis die Gelder wieder hochgefahren werden. Noch hat die öffentliche Hand die Mittel aus der guten Zeit, die werden jetzt ausgegeben. Wenn die Mittel nicht mehr da sind, werden die grossen Sparpakete geschnürt. Angekommen ist die Krise bei jenen, die für ein Projekt private Sponsoren suchen; das ist enorm schwierig geworden.
Wie werden die Institutionen reagieren werden sie durchhalten?
Ich habe persönlich das Gefühl, dass es eine Redimensionierung geben wird. Ich glaube, es gibt viele Institutionen, die, weil es gut ging, am Tropf der öffentlichen Hand überlebten, aber überhaupt keine Polster haben, stets von der Hand in den Mund lebten. Sollte die Krise Jahre dauern, werden einige nicht durchhalten.
Wird die Politik ein Machtwort sprechen und analog zu den Spitallisten neu auch Museums- und Theaterliste erstellen?
Das glaube ich eher nicht, aber die Kantone, der Bund, die Städte werden genauer darauf schauen, ob die Empfänger von Subventionen die anderweitig zu erwirtschaftenden Gelder (Einnahmen, Sponsorenbeiträge, Stiftungserträge etc. A. der Red.) auch wirklich zusammenbringen. Was sicher nicht der Fall sein wird, ist, dass die öffentliche Hand allfällige Schwierigkeiten der Institutionen durch Subventions-Erhöhungen ausgleicht. Die Politik wird sich vielmehr überlegen, ob es im Einzelfall weiterhin Sinn macht, bisherige Subventionen überhaupt zu sprechen oder, wie im Fall der Stadt Bern, beim Stadttheater zum Beispiel darauf zu drängen, auf die Sparte Tanz zu verzichten respektive Orchester und Musiktheater zusammenzulegen.
Die Institutionen sind die eine Seite, was ist mit den Kulturschaffenden, die ja nicht einfach zum Arbeitsamt gehen und Arbeitslosengelder beantragen können?
Sie werden unter der Krise leiden, insbesondere die junge, experimentierfreudige Szene, sei es in der Musik oder in der bildenden Kunst. Denn vor allem im privaten Sektor wird nur noch gesponsert werden, was eher auf allgemeine Anerkennung zählen kann. Überdies ist es so, dass die eigentlichen Förderer junger Kunst in allen Bereichen bisher primär private Stiftungen waren, die zum Teil hervorragende Arbeit geleistet haben. Doch ihre Mittel sind wegen der enormen Verluste auf dem Wertpapiermarkt bis um die Hälfte, ja sogar um zwei Drittel eingebrochen. Selbst grosse Stiftungen wie Nestlé oder Landis & Gyr haben nicht mehr annähernd so viel Geld zu Verfügung. Und die öffentliche Hand wird auch da nicht einfach Lücken schliessen.
Die Problematik sei auch hier einmal von der anderen Seite betrachtet. Wie kommt es eigentlich, dass sich die Kulturschaffenden in eine so launische, risikobehaftete Abhängigkeit begeben haben?
Man muss sehen, dass sich die öffentliche Künstlerförderung in der Schweiz bisher als recht freigiebig erwiesen hat und auch von privater Seite Grosszügigkeit vorhanden war. Und als Folge davon schwimmen viele mit, die letztlich das Potential für eine künstlerische Laufbahn nicht haben. Sie sind da, so lange es Geld gibt und verschwinden dann wieder. Andererseits ist es so, dass es das Umfeld des Mittelmässigen braucht, damit sich gute Blüten bilden und dann auch herausragen können. Da glaube ich, da wird es eine relativ engere Situation geben. Viele Schulabgänger werden gezwungen sein, sich a priori andere Arbeitsfelder suchen. Man muss sich vorstellen, zum Wettbewerb um den Eidgenössischen Kunstpreis melden sich jährlich bis zu 600 Kunstschaffende an und dies bei einer Alterslimite von 40 Jahren!
Besteht nicht die Gefahr, dass so die Kultur an den Rändern, das Neue, das Zeit braucht, um sich zu formulieren, unter die Räder kommt, ähnlich wie in den Jahren des zweiten Weltkrieges?
Es wird sicher schwieriger, aber ich sehe dennoch nicht so schwarz. Die meisten Künstlerinnen und Künstler besuchen heute eine Schule, werden dort in ihrer Entwicklung unterstützt. Dabei können Begabungen viel eher entdeckt werden. Das heisst, es gibt festere Strukturen, auf welche die Kulturschaffenden zählen können.
Aber Kultur ist auch eine Kultur der Möglichkeiten und das geht nicht ohne Geld…
Es ist zu bedenken, dass zur aktuellen Situation auch die Ausweitung des Museums- und Kunsthallenbetriebs sowie der alternativen Kulturforen beigetragen hat. Diese bestellen immer öfter Kunstwerke für zeitlich befristete Projekte. Dabei gerät der Aspekt, dass der Künstler auch Werke schaffen soll, die sich verkaufen lassen und die so seine Existenz sichern, nur zu oft aus dem Blickfeld. Dadurch ist ein Künstlertypus entstanden, der nur noch auf Bestellung im Rahmen von Ausstellungen schafft und sich damit in eine enorme Abhängigkeit begeben hat. Und das kann sich jetzt rächen.
Wie bahnte sich diese Veränderung an?
Früher hat der Staat die Fürsten und die Kirche die Aufträge zur Schaffung von Kunstwerken erteilt, und die Künstler aller Sparten kristallisierten sich aus der Umsetzung dieser Aufträge heraus. Seit der Demokratisierung fördert der Staat die Kunst in erster Linie über die Förderung der Kulturschaffenden. Damit liegt heute eine enorme Selbstverantwortung bei den Künstlern. Das das mag positiv sein, stellt jedoch eine wesentlich labilere Situation dar.
Allerdings ist gerade im Bereich der bildenden Kunst durch das Auftauchen von enorm reichen Sammlern, die in den letzten 20 Jahren immense Sammlungen angelegt haben, eine ähnliche Adels-Abhängigkeit entstand wie es sie in früheren Jahrhunderten gab.
Und was passiert jetzt da?
Wenn es echte Sammler sind das sind nicht alle! – und sie ihre Gelder zumindest teilweise retten konnten, werden sie weiterhin kaufen. Weiter ist es eine Tatsache, das Sammeln von Kunstwerken ist auch zu einem Gesellschaftsplaisir geworden. Wenn Kunstwerke zu absurd hohen Preisen verkauft werden, ist das in allen Zeitungen zu lesen das ist Unterhaltung.
Ist darum die bildende Kunst so stark im Gespräch?
Sie eignete sich gut dafür, Bestandteil unserer Unterhaltungskultur zu werden. Denn bei Kunstwerken ist es nicht wie bei den Rolls Royce es sind Unikate. Man könnte dabei fast philosophisch werden, wenn man sich überlegt, dass ein Sammler ein Kunstwerk erwerben kann, es jedoch immer den Namen seines Schöpfers behält; nicht jenen des Sammlers, das heisst man kann es also nicht ganz kaufen.
Bei den anderen Kultursparten ist das ganz anders!
Ja, diese sind viel mehr Gemeinschaftskunst. Eine Oper kann man nicht kaufen. Aber ein Kunstwerk kann man besitzen.
Heisst das, dass das Musik-, das Sprechtheater, die Neue Musik etc. noch viel abhängiger sind von öffentlichen Geldern?
Ja, das ist so, selbst in diesen schwierigen Zeiten, geht es der bildenden Kunst vergleichsweise immer noch gut. Anders ist es, wenn man die Situation zum Beispiel bei der experimentellen klassischen Musik betrachtet, die es kaum schafft, populär zu werden. Eben gerade wurde im Stadttheater Bern Fervaal von Vincent dIndy, ein keltisches Operndrama, konzertant aufgeführt eine wunderbare Aufführung, aber das Haus war halb leer. Dabei ist die Musik von dIndy nicht einmal modern, sondern das Musikwerk ist bereist 1897 uraufgeführt worden! Und da sehe ich bei einer Kürzung von Kulturgeldern eine grosse Gefahr, dass die Häuser in ihren fianziellen Schwierigkeiten dann gerade solche Aufführungen streichen. Und dies würde ein echter Verlust für die Kultur bedeuten, was bei einer Van Gogh-Ausstellung mehr oder weniger bestimmt nicht der Fall wäre!
Bild: Adrian Streun
